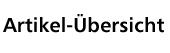Wo stehen wir in Europa?
Zwölf Sternen zieren den blauen Hintergrund der europäischen Flagge. Diese zwölf Sterne stehen nicht etwa für jedes Land in der EU, denn dann würden sie nicht ausreichen; sie stehen für Einigung, Zusammenhalt und Stärke. Doch allerdings trügt der Schein. Denn trotz europäischer Institutionen, wie das Europaparlament, stehen sich die jeweiligen europäischen Länder sehr differenziert gegenüber. Wann eine absolute europäische Einheit eintritt steht allerdings noch in diesen zwölf Sternen. Doch sollte man sich vorab darüber im Klaren sein, dass Europa bei uns beginnt und jeder von uns seinen Teil dazu leisten kann, die verschieden Kulturen und Bräuche einander näherzubringen... von Katharina Mutz, Flora Begrich, Jan-Peter Lambeck und Niko Ippendorf
Die Grenzen öffnen sich. Passkontrollen und lange Wartezeiten an den Autobahnübergängen in andere europäische Länder sind in unserer heutigen Zeit kein Thema mehr. Wer von hier in unsere Nachbarstaaten reist, kann sich die Torturen der Vergangenheit an den Grenzübergängen kaum noch vorstellen. Diese Vorteile haben wir dem Vertrag von Maastrich zu verdanken, durch den die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) untereinander die Europäische Union (EU) gründeten. Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung eines immer engeren Bündnisses der Völker Europas dar, in der die Entscheidungen möglichst im Interesse der Bürger getroffen werden. Die Grundlage der Europäischen Union ist die Verbrüderung der europäischen Staaten, ergänzt durch die mit diesem Vertrag eingeführten Politiken und Formen der Zusammenarbeit. Aufgabe der Europäischen Union ist es, die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten, sowie zwischen ihren Völkern möglichst zusammenhängend und solidarisch zu gestalten. Um dies zu erreichen wurden folgende Ziele gesetzt: Die Förderung eines ausgewogenen und dauerhaften wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts, insbesondere durch Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen, durch Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und durch Errichtung einer Wirtschaft- und Währungsunion, die auf längere Sicht auch eine einheitliche Währung nach Maßgabe dieses Vertrags umfasst. Die Behauptung ihrer Identität auf internationaler Ebene, insbesondere durch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wozu auf längere Sicht auch die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu gegebener Zeit zu einer gemeinsame Verteidigung führen könnte. Die Stärkung des Schutzes der Rechte und Interessen der Angehörigen ihrer Mitgliedstaaten durch Einführung einer Unionsbürgerschaft. Die Entwicklung einer intensiven Zusammenarbeit aller europäischer Länder in den Bereichen Justiz und inneren Angelegenheiten. Die volle Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands und seiner Weiterentwicklung, wobei geprüft wird, inwieweit die durch diesen Vertrag eingeführten Politiken und Formen der Zusammenarbeit mit dem Ziel zu revidieren sind. 
Das Europaparlament - Eine Institution ohne Macht im Kampf gegen alle(s)? Die Einhaltung der in diesem Vertrag vereinbarten Zielen obliegt der Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Jedoch übt ein Europäisches Parlament eine demokratische Kontrolle auf europäischer Ebene aus, um für die Befolgung des Vertrages zu sorgen, ist aber vor allem maßgeblich an der Ausarbeitung, Änderung und Verabschiedung der europäischen Rechtsvorschriften beteiligt und unterbreitet politische Vorschläge zur Stärkung der Europäischen Union. Es engagiert sich für die Wahrung der Menschenrechte und unterhält Beziehungen zu allen demokratisch gewählten Parlamenten in der Welt. Das Europäische Parlament ist die einzige internationale Organisation, deren Mitglieder demokratisch in allgemeiner direkter Wahl gewählt werden. Zur Zeit umfasst das Parlament 626 Mitglieder. Diese Darstellung erweckt den Eindruck, dass das Parlament sehr viel Einfluss hat, doch bis vor kurzem war seine Macht sehr gering, und das, obwohl es schon seit 1979 existiert. Gerade erst am 1. Mai 1999 wurde dem Parlament machtpolitisch durch den Amsterdamer Vertrag, der dem EU-Parlament auf 23 Bereichen (z.B. Verbraucher- u. Umweltschutz) ebenfalls Mitentscheidungsrecht einräumt, unter die Arme gegriffen. Aber das Parlament besitzt nicht nur in vielen Bereichen Mitentscheidungsrechte, sondern hat auch EU-interne Rechte. So kann das EU-Parlament, wenn es bei Gesetzesentwürfen der EU die Interessen der europäischen Bürger nicht ausreichend berücksichtigt sieht, diese ändern lassen oder sogar ganz kippen. Ebenfalls muß das Europäische Parlament der Ernennung der Kommission* zustimmen und hat das Recht, ihr das Misstrauen auszusprechen und dann diese zum Rücktritt veranlassen. Dieses ist dieses Jahr zum erstenmal geschehen: Der erste Bericht der Experten-Kommission, welcher die Missstände in der EU aufdecken soll, hat zum Sturz der Kommission erheblich beigetragen, indem er Korruption, Vetternwirtschaft, Chaos und Missmanagment in der EU festgestellt und aufgedeckt hat. Doch bis eine neue Kommission ernannt und vom Parlament bestätigt wird, kann noch einige Zeit vergehen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass der zweite Bericht des Experten-Komitees, der vor allem über die strukturellen Mängel in Brüssel berichtet, erst für den 13.September angekündigt wurde, und die neue Kommission unter Leitung von Kommissionspräsident Romano Prodi, ehemaliger Ministerpräsident Italiens, eigentlich schon am 20. September ihre Arbeit aufnehmen wollte. Eigentlich herrscht genug Zeit dazwischen, wenn das EU-Parlament nicht jeden Kommissar bestätigen müsste. Dass es nicht jeden bestätigen wird, ist jetzt schon klar, da Herr Prodi vier der alten Kommissare übernehmen will, und zur Demonstration ihren neuen Macht wird das Parlament wenigstens einen davon ablehnen. Eine weitere eventuelle Hürde für die Prodi-Regierung stellt die vergangene Wahl des EU-Parlament dar, denn durch den Sieg der konservativen Parteien (in Deutschland CDU/CSU) besitzen die sozialdemokratischen Parteien (in Deutschland SPD) nicht mehr die Mehrheit, sondern eben die Konservativen. Dazu kommt, dass die deutsche Regierung beide deutschen Kommissare (jedes Land darf zwei Kommissare stellen) aus der Regierung bestimmt hat, während die meisten anderen Länder die ungeschriebene Regelung, jeweils einen Kommissar aus Regierung und Opposition zu stellen, zum Willen der Zusammenarbeit in Europa und zur schnellen Neubildung der Kommission, eingehalten haben. So kann es vorkommen, dass das Parlament die zweite deutsche Kommissarin aus der Regierung (Schreier/Grüne) oder den ersten (Verheugen/SPD) ablehnt, was zur Folge hätte, dass sich die Bildung der Kommission noch weiter verschiebt, da erst einmal wieder ein neuer Kommissar ernannt werden und dieser dann wieder bestätigt werden muss. So ist das EU-Parlament doch kein Papiertiger, sondern kann durch die neuen Machtverhältnisse für eine ausgewogene Balance im Einfluss-bereich der EU sorgen und hoffentlich verhindern, dass sich die unglücklichen Vorfälle der Vergangenheit wiederholen. Um die Vereinigung der einzelnen europäischen Staaten zu einer Einheit voranzutreiben, be-schloss die Europäische Kommission am 5. November 1997 eine Mitteilung unter der folgenden Überschrift: "Auswirkungen der Umstellung auf den Euro und Politik, Institutionen und Recht der Gemeinschaft". 
Darin wurden die praktischen Folgen des Euro für die Gemeinschaftspolitik, die Vereinbarkeit des Gemeinschaftsrechts mit dem Euro sowie die technischen und praktischen Konsequenzen für die Konsequenzen für die Kommission (Infor-mationstechnologie, Verwaltungsumstellungen, Information und Schulung des Personals) einer Bewertung unterzogen. Die Mitteilung beschränkte sich auf die Auswirkungen des Euro auf die bestehende Gemeinschaftspolitiken und das bestehende Gemeinschaftsrecht; Maßnahmen der Gemeinschaft, die zur Einführung des Euro unmittelbar erforderlich sind, wurde darin nicht behandelt (zum Beispiel Vorschriften zur Errichtung der Europäischen Zentralbank, Euro-Informa-tionsprogramm) ebenso wenig wie laufende und neue politische Initiativen in anderen Bereichen, die vom Euro berührt werden könnten. In dieser Aufzeichnung werden die Fortschritte bei der Umsetzung der Mitteilung bis zum 1. Januar 1999, dem Tag der Einführung des Euro, beschrieben. In den weitaus meisten Fällen werden die in der Mitteilung beschriebenen Strategien und Fristen eingehalten. Das Europäische Parlament verabschiedete am 6. Oktober 1998 seinen Bericht (Langen) zu der Mitteilung, worin die Kommission aufgefordert wurde, dem Parlament einen Fort-schrittsbericht vorzulegen. Mit dem vorliegenden Bericht wird diesem Wunsch entsprochen. Die in der Mitteilung beschriebenen Vorbereitungen betreffen zum Teil mittelbar oder unmittelbar andere Gemeinschaftsorgane oder die Mitgliedsstaaten, so zum Beispiel die Umsetzung von Richtlinien der Gemeinschaft im innerstaatlichen Recht. Soweit möglichen werden auch die dabei erzielten Fortschritte in der vorliegenden Aufzeichnung zusammenfasst, doch ist diese nicht erschöpfend. Die Generaldirektor "Wirtschaft und Finanzen" hat jedoch einen Überblick über die Vorbereitungen der öffentlichen Verwaltung in den einzelnen Mitgliedstaaten auf den EURO veröffentlicht. Um den EURO einführen zu können müssen die Länder der Europäischen Union Bedingungen erfüllen, die im Vertrag von Maastrich ausgearbeitet und als verbindlich anerkannt wurden. Die Kommission berichtet dem Rat, inwieweit die Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen sind. In ihren Berichten wird auch die Frage geprüft, inwieweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten einschließlich der Satzung der jeweiligen nationalen (Unabhängigkeit der Zentralbank) sowie der Satzung der ESZB vereinbar sind. Ferner wird darin geprüft, ob ein hoher Grad an dauerhafter Konvergenz erreicht ist; Maßstab hierfür ist, ob die einzelnen Mitgliedstaaten folgende Kriterien erfüllen:
Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, ersichtlich aus einer Inflationsrate, die der Inflationsrate jener - höchstens drei - Mitgliedstaaten nahekommt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben. Eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit. Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmecha-nismus des Europäischen Währungssystems seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertung gegenüber der Währung eines anderen Mitgliedstaats. Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat erreichten Konvergenz und seiner Teilnahme am Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems, die im Niveau der langfristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt. Doch nicht alle europäischen Länder konnten diese Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel Griechenland. es hofft jedoch in den nächsten Jahren auch den EURO als gültige Währung einführen zu können. Aber auch Länder, die allen Bedingungen gerecht wurden, lehnen den EURO ab und halten weiterhin an ihrer alten Währung fest, wie zum Beispiel Großbritannien. Bisher war der Ärmelkanal nur eine politische Trennlinie, da Großbritannien mit seiner Europapolitik der Annäherung bei gleichzeitiger Abschottung, als einzige der bedeutenden europäischen Nationen nicht am Euro teilnimmt. Jetzt aber wurde der Kanal auch zur wirtschaftlichen Trennlinie, da die deutsche DASA mit der französischen Aerospatial Matra fusionierte, während die britische British Aerospace, dritter Partner bei Airbus, außen vorsteht. Allerdings war es nicht, wie es zum Beispiel durch die Anwesenheit der beiden Außenminister beim Vertragsabschluß erschien, ein weiterer Beweis für die Stärke der deutsch- französischen Achse, dem "europäischen Motor", sondern eher zweite Wahl. Die DASA hätte nämlich lieber mit den Briten fusioniert, die aber lieber alleine blieben. Solche Schritte führen nicht zu dieser erhofften innereuropäischen Einigung. Doch nicht nur im großen und politischen Rahmen kann man die verschiedenen Kulturen Europas einander näherbringen. So erfährt man zum Beispiel durch Auslandsaufenthalte viel über die Sitten und Bräuche anderer Länder. In diesem Sinne wurde in Köln eine Europaschule ins Leben gerufen, in der Schüler aus den verschiedenen Ländern Europas unterrichtet werden. In der "Europaschule Köln" sind die Klassen bunt gemischt und der Unterricht ist multikulturell. Wie sich das Zusammenleben der aus mehr als 30 verschiedenen Nationen stammenden Jugendlichen gestaltet, und wieso Schüler, Eltern und Lehrer solch eine Schulform erarbeitet haben, erfahrt Ihr im folgenden. 
Europa ist multikulturell - ebenso auch die "Europaschule Köln" Alle 931 Schüler, Lehrer und Eltern der Gesamtschule Zollstock im Süden der Domstadt, besser bekannt als "Europaschule Köln" verbindet ein gemeinsames Ziel - die Schaffung einer Schulform, die die Schüler auf die Anforderungen des vereinten Europas vorbereiten soll. Der Unterricht in den multikulturellen Klassen zeichnet sich vor allem durch eine enorme Sprachenvielfalt aus: Das Erlernen von drei neuen Sprachen ist Pflicht; und diese ungewöhnlichen Maßnahmen stellen manchmal auch die Lehrkräfte vor schwierige Probleme. "Es gibt einfach keine Bücher, um Zwölfjährigen Portugiesisch beizubringen" , erklärt Frau Nagele, die Direktorin der Schule. So mussten die Lehrkräfte zum Teil eigenes Unterrichtsmaterial entwickeln, um ihren Schülern die Ausbildung zu ermöglichen, die sie auf die Anforderungen der Wisssensgesellschaft in einem vereinten Europa vorbereiten sollen. Übrigens haben erst kürzlich 27 europaorientierte Schulen eine "Kölner Erklärung" unterzeichnet, in der ein Leitbild für die Schule der Zukunft formuliert wurde, für das die Lehrer engagiert arbeiten. Für die jungen Kölner ist das Modellprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen längst zum Alltag geworden. In den Klassen sitzen Türken neben Italienern, Deutsche neben Bosniern. Sie alle bilden ein eingespieltes Team, in dem fremde Nationalitäten - knapp ein Drittel der Schüler kommt aus dem Ausland- oder andersartiges Aussehen keine Rolle spielen. Was in anderen Schulen längst zur Normalität gehört, Gewalt unter Schülern, gibt es hier gar nicht oder kaum. Eines der wichtigsten Ziele dieser Schulform, nämlich die Vermittlung und Toleranz gegenüber Andersdenkenden, konnte also schon verwirklicht werden. Aber nicht nur das Verstehen anderer Kulturen soll gefördert werden, die Lehrer haben sich auch zum Ziel gemacht, Berufsqualifikationen zu vermitteln. "Wir wollen, dass unsere Schüler fit sind für Europa." Dazu gehört auch, dass ab der 98.Klasse "Europaqualifikation" trainiert wird. Durch Workshops zum Thema "Was passiert, wenn ich von Deutschland nach Belgien umziehe?", durch Betriebspraktika im Ausland, Austauschfahrten oder e-Mail Freundschaften im Ausland wollen die Lehrer versuchen, ihren Schülern trotz der erschreckend hohen Arbeitslosigkeit, gute Berufschancen auf den Standards des vereinten Europas zu ermöglichen. Allein in der Bundesrepublik Deutschland gibt es ca. hundert dieser europaorientierten Schulen, von der Grundschule bis hin zur Berufsschule. Vielleicht ist das Modellprojekt in Köln wirklich die Schulform für das nächste Jahrtausend, weil es der weiteren Entwicklung des Rechtsradikalismus und der Gewalt an unseren Schulen durch ein multikulturelles Miteinander vorbeugt. Aber nicht nur in diesem Rahmen wurden in Köln Maßnahmen zur besseren Völkerverständigung ergriffen. So fanden sich Europäerinnen zusammen, die ein vielversprechendes Projekt angingen. Die wohl europäischste Wohngemeinschaft aller Zeiten - "WG Europa" Seit dem ersten Mai 1999 existiert in Köln die sogenannte "WG-Europa" . Der Zweck dieser Gemeinschaft ist es den Bewohnern aber auch der Öffentlichkeit zu demonstrieren ,wie sich Europa leben lässt. Folgende sechs Personen wurden für dieses Pilotprojekt ausgewählt: Esette Kinsella ist 30 Jahre alt. Ursprünglich kommt sie aus Dublin (Irland) ,lebt aber schon seit neun Jahren in Deutschland. Sie ist die jüngste von sechs Kindern, die bis auf sie und eine Schwester, die zur Zeit in Sydney wohnt, noch in Irland leben. Simon kommt aus Gütersloh und ist am 9.01.76 geboren. Nach seinem ABI 95 machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Zur Zeit ist er Praktikant bei VIVA 2. Silvio Speca hat als Hobby Pornofilme gucken. Er ist am 15.03.70 geboren und kommt aus Mailand (Italien).Er ist ein super Comiczeichner, und hat auch eine Schule besucht, die Zeichner ausbildet. Przemek Rogala ist am 17.04.76 in Lopz (Polen) geboren. Er ist Musiker mit Leib und Seele, und studiert zur Zeit an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Sein größtes Ziel ist es, Pianist und Dirigent zu werden. Seit seinem siebten Lebensjahr erhält er Klavierunterricht, und ist Keyborder von "Sucks-A-PHONE", dem Newcomer des Monats April bei VIVA. 1998 hat er sein ABI am Humboldt-Gymnasium in Köln gemacht. Stefan Martin aus Frankreich und Camino Gonzales aus Spanien wohnen auch in der WG. Wir konnten sie aber leider nicht kennenlernen, da sie zur Zeit in Urlaub sind. 
Organisiert haben diese buntgemischte Wohngemeinschaft zwei freie Mitarbeiter des WDR, Petra Nagel und Florian von Stelten, für die Sendung "Boulevard Europa". Vor allem aus Neugierde aber auch auf Grund des mietfreien Wohnens entschlossen sich die vier, sich für das multikulturelle Projekt zu bewerben. Ihre ca. fünfminütigen Videotapes kamen bei den für das Auswahlverfahren verantwortlichen Leuten scheinbar gut an; sie durften mitmachen. Kurz vor Beginn des Projektes, Anfang Mai 1999 trafen sich Przemek, Silvio und Simon zum ersten Mal. Ein wenig Skepsis hatten sie schon bei ihrem "Blind Date", aber schließlich war das mietfreie Wohnen ein unübersehbarer Vorteil und so wurden alle Befürchtungen und Ängste über Bord geworfen. Nach dem Motto: Erst mal sehen was kommt! Trotz der durchweg positiven Einstellung der Teilnehmer gab es zu Anfang einige Probleme: Przemek musste vier lange Wochen auf sein Hochbett warten und konnte deshalb erst später einziehen. Außerdem gab es Schwierigkeiten mit der Zimmerverteilung: Ein Raum der Wohnung ist sehr klein, und weil dort verständlicherweise niemand freiwillig einziehen wollte, musste gelost werden. Nun wird das Zimmer im ersten halben Jahr von Przemek, im zweiten von Silvio bewohnt. Seit diese organisatorischen Probleme gelöst sind, verläuft das Zusammenleben der vier im Ganzen sehr gut: Besonders das Kennenlernen der verschiedenen Mentalitäten und Bräuche finden Simon, Silvio und Przemek interessant. Darüberhinaus entstehen Kontakte in ganz Europa, die man nach Meinung der vier WG-ler auf jeden Fall pflegen sollte. Positiv bewerten sie auch, dass jeder von ihnen wichtige und neue Erfahrungen gemacht hat, die im späteren Leben bestimmt sehr hilfreich sein werden. Inzwischen, nach knapp einem halben Jahr, haben sich alle etwas besser kennengelernt, und unter den meisten ist ein freundschaftliches Verhältnis entstanden. Die Nationalität der einzelnen ist dabei in den Hintergrund getreten, stattdessen sind die netten Charakterzüge wichtiger geworden. Kurz gesagt: Das multikulturelle Zusammenleben ist zu einem reizvollen Alltag geworden. Natürlich gibt es auch in der "WG-Europa" Probleme, wenn z.B. wieder jemand vergessen hat, das Badezimmer zu putzen oder das Geschirr zu spülen. Solche Kleinigkeiten können die große Leistung des Projekts, das noch bis Ende April 2000 läuft, jedoch nicht beeinträchtigen. Das Modellprojekt ist eine große Errungenschaft und zeigt, wie Europa in Zukunft gestaltet werden kann und wie man aktiv zur Verständigung der verschiedenen Nationen beitragen kann. Deshalb bleibt zu erwarten, dass bald viele Länder Europas diesem erfolgreichen Beispiel Folge leisten werden, um eine bessere Verständigung in Europa zu schaffen. Doch sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass auch wir unseren Teil zu einem multkulturellen Beisammensein beitragen können. In dem man, anstatt Vorurteile gegenüber Menschen, die einen anderen Glauben und andere Sitten haben als man selbst, zu hegen, sollte man sich lieber über ihre Bräuche informieren um sie zu verstehen. Solche und ähnliche Schritte können schon in kleinen zu einer europäischen Einheit führen. Vielleicht wird dann der Traum von einem vereinigtem Europa doch Wirklichkeit. Sollte dem so sein stehen die zwölf Sterne der europäischen Flagge wirklich für Stärke und Einheit. Doch bis dahin ist es noch ein langer und steiniger Weg, den es sich aber zu begehen lohnt.
* Die Europäische Kommission setzt sich aus 20 Mitgliedern zusammen. Diese üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit von den nationalen Regierungen, von denen sie ernannt werden, aus und handeln als Kollegium. Die Kommission erarbeitet Vorschläge für Rechtsvorschriften und Maßnahmen auf europäischer Ebene, wacht über deren Anwendung und koordiniert die gemeinschaftlichen Politiken.