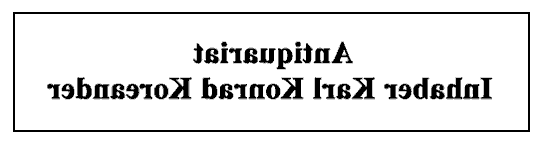

die unvollendete zählt zu den ältesten SchülerzeitungenDeutschlands. In 40 Jahren erschien sie schon über hundert Mal. Klar, dass da nostalgischeGefühle aufkommen...
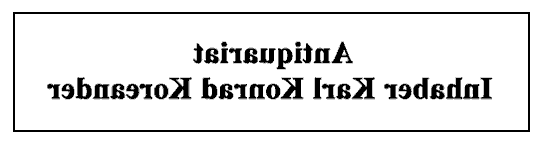
Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens, aberso sah sie natürlich nur aus, wenn man vom Inneren des dämmerigen Raumes durch dieScheibe auf die Straße blickte.
Mit diesen Worten nimmt die unendliche Geschichte von Michael Ende ihren Lauf. 40 Jahre sindfür eine Schülerzeitung auch ein bißchen unendlich - das wird uns spätestensklar, als wir in Hamburg beim Interview vor zwei der Gründerväter der unvollendetensitzen. Rainer Frenkel und Wolfram Bickerich (beide 56) sind heute bei der ZEIT und beim SPIEGELtätig. Sie sind der Anfang unserer Geschichte, keiner unendlichen, aber der unvollendetenGeschichte. Einer Geschichte, die sich nicht zwischen zwei Buchdeckel pressen läßt.Einer Geschichte in 100 Teilen auf 5000 Seiten...
Sie beginnt an einem Tag wie jedem anderen. Vielleicht scheint die Sonne, vielleicht regnet es.In einem kleinen Stehcafe am Wall trifft sich nach Schulschluß eine Gruppe von Schülerndes Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums. Irgendwo zwischen Kaffeeduft und Zigarettenqualm versucht man,einen Hauch von der großen Welt zu spüren, die man irgendwo da draußen wähnt -einer Welt, von der man eigentlich nicht viel weiß, über die aber auch nicht geredetwird.
Seit 45 will niemand mehr etwas von Politik wissen. Man sieht lieber, daß man selbstwieder zu ein bißchen Wohlstand kommt. Wen kümmert es schon, ob Adenauer denehemaligen NS-Waffenexperten Globke zu seinem engsten Berater macht oder nicht?."Eine etwas muffige Stimmung", nennt es Wolfram Bickerich schlechte Zeiten für einen jungenMenschen, um sich ein Bild von seiner Umwelt zu machen. Zu Hause haben wir so gut wie nieüber Politik geredet, so wenig wie in der Schule", erinnert sich Rainer Frenkel.Aber man fragt auch nicht. Mit der SV dringen zwar die ersten Früchte einer jungen Demokratiein das damals sehr konservativ strukturierte Gymnasium, doch alles verläuft sehr kooperativund freundlich. Man kommt einfach nicht darauf, etwas zu fordern. So ist das eben, in dieserZeit... und man versinkt wieder in Gedanken über seiner Kaffeetasse. Doch dann hat auf einmaljemand diese Idee. Was wäre, wenn man eine Schülerzeitung machen würde? DerZigarettendunst lichtet sich ein wenig. Fünf, vielleicht sechs Köpfe schauen von ihrenKaffeetassen auf. Naja, nur so zum Spaß halt, mal sehen was passiert. "Wir haben dashauptsächlich unter dem Spaßfaktor gesehen.", erinnert sich Frenkei. "Sicherlich spieltenAusprobieren und Neugierde eine Rolle. Man suchte die Diskussion über das, was manmachte.
Das eigentlich Neue aber war, Tagespolitik wahrzunehmen und zu interpretieren. Wir lasen dannselbst Zeitung und überlegten, welche Bedeutung diese Dinge für uns haben und wieman das anderen erklären kann. Ich glaube, an dem Punkt haben wir wirklich versucht, einThema zu besetzen, das es in der Schule nicht gab." - erste zaghafte Versuche zu begreifen,was in der Welt passiert, ein wenig Erwachsenspielen. Vielleicht war es auch "ein bisschenProtest gegen die Älteren, gewürzt mit dem Versuch, Informationen zu verbreiten, dienicht vorher im Lehrerzimmer per Akklamation gebilligt waren", wie Wolfram Bickench es vor10 Jahren in einem Rückblick formulierte.
Doch der Spaß stand im Vordergrund, das Loblied auf die mutigen Gründer muss ausbleiben.Kein "emotionaler Akt oder Aufschrei gegen die Autoritäten in der Schule" (Bickerich)brachte die unvollendete hervor. Verklärte Vorstellungen von Widerstand, vonrevolutionären Visionen und dem Kampf um das Recht auf eine Schülerzeitung und freieMeinungsäußerung gehören ins Reich der Phantasie. Die Realität sah reichlichunspektakulär aus. "Wir waren keine Helden, wir waren keine Kämpfer. Traurig zu sagen.Alles was heute hineininterpretiert nach dem Motto: 'endlich tauchten wir auf und sagten denanderen wo es lang geht', das kam alles erst später.", stellt Rainer Frenkel richtig "Eswaren sehr normale Zeiten. Von heute aus gesehen ziemlich langweilige erste Schritte politischenErwachsenwerdens." Seltsam... Klang doch Klaus Keldenich, ein weiterer im Bunde der ersten,im UV-Interview vor 12 Jahren noch ganz anders: "Natürlich gab es Widerstand, vehementenWiderstand sogar, von Seiten des damaligen Direktors Heyn. Mit Hartnäckigkeit und der Hilfedes Vertrauenslehrers haben wir es dann geschafft." "Naja, die eine oder andere Schwierigkeit hates gewiß gegeben", räumt Bickench am nächsten Morgen in seinem SPIEGEL-Büro ein."Vielleicht sieht man das heute alles etwas relativierter, doch ich bin sicher: groß waren daProbleme nicht." - Kaffedampf und Zigarettenrauch ziehen wieder auf und verhüllen die Detailsder ersten Stunden für immer in einer Dunstwolke. Immerhin: "Als Pioniere fühlte mansich schon ein bißchen", meint Frenkel - die Gründerehre ist gerettet. Zu denungeklärten Einzelheiten zählt auch der Ursprung des Namens, fürden es wohl ebenso viele Erklärungen gibt wie er Buchstaben hat. Die sicherlich ausgefallensteTheorie besagt, der unvollendete Zustand des im Aufbau befindlichen Schulgebäudes habe Pategestanden. In Frenkels "möglicherweise idealisierender" Erinnerung ist es eine ironischeAnlehnung an Schuberts Unvollendete. Doch die naheliegendste Erklärung ist sicherlichdie schönste und klingt in den Worten von Wolfram Bickenso: "Wenn wir eines wußten,dann dies: Es war alles sehr unvollkommen. Das gab uns den Namen." Lediglich fünf Redakteurewaren an der ersten Ausgabe beteiligt: Fünf Herren aus der 12b oder Unterprima b, wie dasdamals noch hieß. Das weibliche Geschlecht war schon immer unterrepräsentiert in derUV-Geschichte. Auf mehr als ein Drittel der Redaktionsmitglieder hat man es nie gebracht. Erstmit Ausgabe 58, nachdem es die UV bereits 20 Jahre lang gab, wurde ein Mädchen Chefredakteurin.Es folgten immerhin zwei weitere, doch die letzte verließ die Redaktion bereits 1983, undheute sieht es nicht anders aus.
Ansonsten hat sich aber vieles geändert, möchte man meinen. Doch hat es wirklich? Sicherist die UV dicker geworden, sicher ist das Format seit 1985 A4, sicher ist sie moderner gewordenund vielleicht auch ein bißchen professioneller, doch der Blick unter die Oberflächeernüchtert... Viel Schulinternes, Theater- und Filmkritiken, die Rubrik "Wir stellen richtig"als ein Vorläufer von "Stimmt es, daß..." und einen einzelnen politischen Artikelbeinhaltet die erste Ausgabe. Ein knappes Jahr später kommen Musik- und Sportthemen hinzu.Alle zwei Monate hielten die Leser damals noch eine neue Ausgabe in den Händen. DerenReaktionen reichten von Gleichgültigkeit bis Begeisterung, aber neugierig waren alle, alsdas erste Heft erschien. ,,Obwohl: Die dreißig Pfennig, die es gekostet hat... da war eseigentlich schon besser, wenn man die nicht bezahlen mußte. Man brauchte das Geld ja zumBeispiel für das Kaffeetrinken bei Tschibo.", meint Bickench. "Aber ich glaube schon, daßdie Zeitung freundlich aufgenommen wurde", erwidert Frenkel, "allerdings ohne, dass viele dasGefühl gehabt hätten, sie müßten mitmachen. Die Zeitung wurde gern gelesen,aber erstellen wollten sie eigentlich nur die wenigsten."
Jetzt zweifeln wir endgültig, dass sich in 40 Jahren etwas verändert hat: Seit derersten Ausgabe enthielten die Vorworte in regelmäßigen Abständen Klagen überdie mangelnde Aktivität der Schülerschaft, die Gleichgültigkeit gegenüberder UV. "Produkt intellektueller Selbstbefriedigung" hat sie der ehemalige Chefredakteur JörgNothdurft genannt. Und Stefan Koldehoff führt in einem Rückblick zum 30jähngenJubiläum vor zehn Jahren aus: ",Man liest die UV, man spricht in den Pausen über ihreFilmtips und amüsiert sich über die Lehrerzitate. Einen Leserbrief habe ich in denmittlerweile sechs Jahren, in denen ich ihre Entwicklung verfolge, nie gesehen. Es wohl nichtschick, nicht cool, sich zu äußern." Wenige Ausnahmen hat es gegeben. Die 68er-Bewegungzum Beispiel, die auch der UV nicht spurlos vorbeiging. Der politische Teil schwoll gewaltig an,Literatur und Kunst nahmen einen höheren Stellenwert ein. Themen wie "Blumen für Polizei","Die Wahrheit über LSD" und "Was will die neue Linke" waren es, die Gemüter erhitztenund das Inhaltsverzeichnis der UV füllten. "Protest!", schreit es einem vom Titel der Ausgabe39 in dicken roten Lettern entgegen. Selbst den einen oder anderen Leserbrief gab es. Für eineZeit war die UV ein bißchen das, was immer sein wollte: Diskussionforum. Auf jeden Fall aberhatte sie sich als Schülerzeitung am WDG etabliert. 1969 feierte man das 10jährigeBestehen.
Und dann ist die UV in den Schlagzeilen.
Auf einmal interessieren sich der General-Anzeiger und sogar der WDR für unser Blatt. Was wargeschehen? In Nr. 39, im Oktober 1970, hatte die Redaktion Gedichte von Pastor Schneider, derinzwischen im Ruhestand ist, veröffentlicht, die heftige Diskussionen auslösten. Derdamalige Direktor Dr. Wilsing sah sich gezwungen aufgrund "solch politisch einseitiger Gedichte"rechtliche Schritte einzuleiten und die Versetzung Hernn Schneiders erwirken. Dagegen erhob sichaber die Schülerschaft, die UV brachte eine Sonderausgabe mit Stellungnahmen heraus,Generalanzeiger und WDR berichteten. Resultat war, daß Herr Schneider bleiben durfte, Dr.Wilsing in den vorzeitigen Ruhestand ging, und Ulrich Ippendorf, damals Chefredakteur, aus Protestzurücktrat zuviel hatte man der Redaktion ins Handwerk gepfuscht, zu massiv warenZensurversuche deutlich geworden.
Solche Zeiten sind vorbei. Zensur und Kontrolle sind inzwischen gesetzlich untersagt, und als Folgeeiniger Schwierigkeiten zu Beginn der Amtszeit der gegenwärtigen Redaktion ist die UV seit 1995auch finanziell unabhängig von der Schule: Der Titel "Freie" Schülerzeitung, den wirübrigens erst seit 1990 tragen, ist nicht nur eine Floskel...
Ein weiteres Mal war die UV mit ihrer Berichterstattung direkt am Puls der Zeit, sogar derProfi-Presse voraus: 1985 sorgte der Fall Beindorf-Wagner für Schlagzeilen. VolkerBeindorf-Wagner war nach einer auf ein Jahr befristeten Einstellung als Kunstlehrer am WDGentlassen worden. Für seine Fächerkombination bestünde kein Bedarf. Tatsächlichaber klaffte zu Beginn des neuen Schuljahres eine Lücke von 20 Fehlstunden im Stundenplan,zahlreicher Kunstunterricht mußte schlichtweg ausfallen: Die Schüler gingen auf dieBarrikaden, um für die Wiedereinstellung des zu beliebten Lehrers zu kämpfen. Die UVgriff den Fall auf, veranstaltete u.a. mit der SV eine Unterschriftenaktion und versorgte die WZmit Informationen. Doch die Profipresse reagierte viel langsamer. Über eine Woche dauerte es,doch dann folgten ein Leitartikel im Generalanzeiger und bundesweite Meldungen über RadioLuxemburg. Auch die UV blieb weiter am Ball und zog im Herbst in einem Leitartikel Bilanz. DerPresserummel hatte immerhin bewirkt, daß Herr Beindorf-Wagner eine gute Anstellung an einerPrivatschule bekam. So viel zu journalistischen Highlights aus 40 Jahren...
Doch Geschichte geht nicht zu Ende, Geschichte wird ständig neu geschrieben, insbesondere wennes eine unvollendete Geschichte ist. So liegt der 100. Ausgabe mit Interviews in Hamburg, Bonnund Kassel wieder ein bisher einzigartiger journalistischer Aufwand in der UV-Geschichte zugrunde.Ein neuer Höhepunkt in einer Entwicklung, die ein wenig wie Achterbahnfahren ist.Die zwangsläufig häufigen Redaktionswechsel, die selten fließenden Übergänge,sorgten schon immer für ein beständiges Auf- und Ab in der Qualität. Zwar ist dasschlimmste Chaos vergangener Zeiten überwunden (manche Ausgabe hatte noch nicht ein mal einInhaltsverzeichnis), doch immer noch läßt die Organisation zu wünschen übrig.Die Zeitung, die man nach endlosen Nächte in den Händen hält ist selten das, was manam Anfang geplant hat - dennoch ist sie überzeugend. Dennoch hat die unvollendete 40 Jahreüberstehen können, ist sie zu einer der ältesten Schülerzeitungen Deutschlandsund zur festen Institution unserer Schule geworden. Was er damals geglaubt habe, wie lange dieZeitung bestehen würde, wollen wir von Rainer Frenkel noch wissen. "Für immer natürlich", sagt er. Und er sagt es mit Überzeugung.